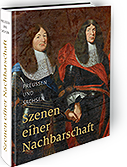Preußen und Sachsen
Szenen einer Nachbarschaft
Erste Brandenburgische Landesausstellung
Schloss Doberlug, Schlossplatz 1, 03253 Doberlug-Kirchhain
7. Juni bis 2. November 2014
Ausstellung ist beendet – Seite wird nicht mehr aktualisiert
Preußen und Sachsen. Szenen einer Nachbarschaft
Die Ausstellung
Der Titel ist Programm
 Als weltweit erste große kulturhistorische Ausstellung wird die Erste Brandenburgische Landesausstellung die spannungsreiche Beziehungsgeschichte der Nachbarländer Preußen und Sachsen erzählen.
Als weltweit erste große kulturhistorische Ausstellung wird die Erste Brandenburgische Landesausstellung die spannungsreiche Beziehungsgeschichte der Nachbarländer Preußen und Sachsen erzählen.
Diese war von kulturellem und wirtschaftlichem Austausch bestimmt, doch auch von Rivalität bis hin zu offener Feindschaft. Hochkarätige Kunstwerke, einmalige Geschichtszeugnisse und mediale Anwendungen lassen Szenen der wechselvollen preußisch-sächsischen »Beziehungskiste« lebendig werden. Im Mittelpunkt steht die Zeit von der Mitte des 17. bis zum 19. Jahrhundert.
Der Anlass
Das 200. Jubiläum des Wiener Kongresses
 Das 200. Jubiläum des Wiener Kongresses von 1814/15 gibt den Anlass für die Landesausstellung. In seiner Folge wurde Europa neu geordnet, und große Teile von Sachsen fielen an Preußen, darunter auch die Niederlausitz sowie die Hälfte der Oberlausitz – die Region, »wo Preußen Sachsen küsst«. Von einem Tag zum anderen wurden die dort lebenden Menschen von Sachsen zu Preußen. Spuren dieser wechselvollen Vergangenheit finden sich in Südbrandenburg bis heute.
Das 200. Jubiläum des Wiener Kongresses von 1814/15 gibt den Anlass für die Landesausstellung. In seiner Folge wurde Europa neu geordnet, und große Teile von Sachsen fielen an Preußen, darunter auch die Niederlausitz sowie die Hälfte der Oberlausitz – die Region, »wo Preußen Sachsen küsst«. Von einem Tag zum anderen wurden die dort lebenden Menschen von Sachsen zu Preußen. Spuren dieser wechselvollen Vergangenheit finden sich in Südbrandenburg bis heute.
Schloss Doberlug
Für die Landesausstellung wachgeküsst
 Stattfinden wird die Erste Brandenburgische Landesausstellung in der Doppelstadt Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster, einem für das Thema der großen Ausstellung authentischen Ort. Schauplatz und zugleich Herzstück der Ausstellung ist Schloss Doberlug, das ehemals zum Besitz der Kurfürsten von Sachsen zählte. Mit der Landesausstellung wird das sorgfältig sanierte Renaissanceschloss, die »sächsische Perle Brandenburgs«, erstmals wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Stattfinden wird die Erste Brandenburgische Landesausstellung in der Doppelstadt Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster, einem für das Thema der großen Ausstellung authentischen Ort. Schauplatz und zugleich Herzstück der Ausstellung ist Schloss Doberlug, das ehemals zum Besitz der Kurfürsten von Sachsen zählte. Mit der Landesausstellung wird das sorgfältig sanierte Renaissanceschloss, die »sächsische Perle Brandenburgs«, erstmals wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Preußen und Sachsen.
Szenen einer Nachbarschaft
Ausstellungskonzept
 Musenküsse, Verräterküsse, Pferdeküsse: Die Ausstellung beleuchtet auf über 800 Quadratmetern die Eigenart und Bedeutung der preußisch-sächsischen Beziehungen, ihre Höhen und Tiefen, ihre Licht- und Schattenseiten und setzt sich mit den unterschiedlichsten sozial-, kultur- und geistesgeschichtlichen Aspekten der preußisch-sächsischen Nachbarschaft auseinander. Dabei werden nicht zuletzt auch die Klischees von Sachsens Glanz und Preußens Gloria hinterfragt.
Musenküsse, Verräterküsse, Pferdeküsse: Die Ausstellung beleuchtet auf über 800 Quadratmetern die Eigenart und Bedeutung der preußisch-sächsischen Beziehungen, ihre Höhen und Tiefen, ihre Licht- und Schattenseiten und setzt sich mit den unterschiedlichsten sozial-, kultur- und geistesgeschichtlichen Aspekten der preußisch-sächsischen Nachbarschaft auseinander. Dabei werden nicht zuletzt auch die Klischees von Sachsens Glanz und Preußens Gloria hinterfragt.

Die Szenen
Szene 1
Partner und Rivalen
 Ein Händedruck für die Ewigkeit. Freundschaftsbildnisse der Herrscher von Brandenburg-Preußen und Sachsen halten die Verbundenheit fest. Die dargestellte Eintracht der beiden Nachbarn entsprach jedoch nicht immer der Wirklichkeit.
Ein Händedruck für die Ewigkeit. Freundschaftsbildnisse der Herrscher von Brandenburg-Preußen und Sachsen halten die Verbundenheit fest. Die dargestellte Eintracht der beiden Nachbarn entsprach jedoch nicht immer der Wirklichkeit.
Als Partner und Rivalen stehen sie nebeneinander – links der brandenburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm und rechts der sächsische Kurfürst Johann Georg II.
Lange Zeit gab das reiche und mächtige Sachsen gegenüber dem ärmeren Nachbarn den Ton an, doch Ende des 17. Jahrhunderts stieg Brandenburg-Preußen auf zum Partner auf Augenhöhe. Zu jener Zeit vereinte die beiden Kurfürsten ein gemeinsames Ziel: der Wunsch, die Königswürde zu erlangen.
Szene 2
Königskunst
 Anfang des 18. Jahrhunderts entstand dieser kostbare Pokal als gemeinsames Werk des sächsischen Bildhauers Balthasar Permoser und des preußischen Goldschmieds Bernhard Quippe.
Anfang des 18. Jahrhunderts entstand dieser kostbare Pokal als gemeinsames Werk des sächsischen Bildhauers Balthasar Permoser und des preußischen Goldschmieds Bernhard Quippe.
In dieser Zeit herrschte ein reger Austausch zwischen den Künstlern, die für die Höfe in Dresden und Berlin arbeiteten. Ihren Auftraggebern war der Aufstieg in den Reigen der gekrönten Häupter Europas gelungen. Als Könige bauten sie ihre Residenzen prachtvoll aus, legten großzügige Sammlungen an und taten alles, um ihrem neuen Rang den nötigen Glanz zu verleihen. Dabei beäugten sie aufmerksam, was jeweils am benachbarten Königshof entstand. Die Künste in Sachsen und Preußen profitierten vom kulturellen Wettstreit der Könige.
Szene 3
Glaubenssache
 Der Wappenschild mit Kurschwertern und Rautenkranz gehört dem Kurfürsten von Sachsen, der rote Adler kennzeichnet den Brandenburger. Gemeinsam stehen die Kurfürsten ein für das lutherische Bekenntnis.
Der Wappenschild mit Kurschwertern und Rautenkranz gehört dem Kurfürsten von Sachsen, der rote Adler kennzeichnet den Brandenburger. Gemeinsam stehen die Kurfürsten ein für das lutherische Bekenntnis.
Sachsen und Brandenburg-Preußen gelten als Schutzmächte des Luthertums. Noch das Luckauer Gemälde vom Ende des 17. Jahrhunderts zeigt die beiden Herrscher als Garanten dieses Bekenntnisses. Doch schon seit 1613 zählte der brandenburgische Kurfürst zu den Reformierten. Und der sächsische Kurfürst trat 1697 zum katholischen Glauben über, denn nur so konnte er König von Polen werden. Die Untertanen blieben in der weiten Mehrheit gut lutherisch, in Preußen wie in Sachsen.
Szene 4
Von Glanz und Gloria
 Landesgrenzen hatten wenig Bedeutung für den Adel in Preußen und Sachsen. Dies lässt sich an der Ahnentafel des Johann von Schöning ablesen.
Landesgrenzen hatten wenig Bedeutung für den Adel in Preußen und Sachsen. Dies lässt sich an der Ahnentafel des Johann von Schöning ablesen.
Sein Vater wechselte aus dem preußischen in den kursächsischen Dienst, als Militär machte er dort Karriere. Auch Johann von Schöning diente am sächsischen Hof als Kammerherr, trotzdem zeichnete ihn der preußische Herrscher mit der Aufnahme in den Johanniterorden aus. Schönings Tochter und Erbin wiederum ging zurück nach Preußen, wo sich die Güter der Familie befanden, und heiratete dort einen preußischen Offizier. Ein Beispiel unter vielen für die Geschichte adligen Lebens zwischen den Höfen in Berlin und Dresden.
Szene 5
Um die Vormacht
 Im fröhlichen Reigen drehen sich drei Grazien. Es sind die Verkörperungen Sachsens, Polens und Frankreichs. Sie feiern die Vermählung einer sächsischen Prinzessin mit dem französischen Thronfolger 1747.
Im fröhlichen Reigen drehen sich drei Grazien. Es sind die Verkörperungen Sachsens, Polens und Frankreichs. Sie feiern die Vermählung einer sächsischen Prinzessin mit dem französischen Thronfolger 1747.
Im Spiel der europäischen Mächte konkurrierten Preußen und Sachsen Mitte des 18. Jahrhunderts um die Vormacht. Auf dem Heiratsmarkt agierte Sachsen dabei erfolgreicher als sein Nachbar. Als der preußische König 1756 ohne Kriegserklärung in Sachsen einfiel, endete das glanzvolle augustäische Zeitalter. Gezielt ließ Friedrich II. das Land während des Siebenjährigen Krieges ausbluten. Kein Wunder, dass Friedrich für Sachsen bis heute nicht »der Große« ist!
Szene 6
Im Dialog
 Intensive Verbindungen zwischen Künstlern, Literaten und Wissenschaftlern prägten die preußisch-sächsischen Beziehungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – der Hochzeit der Aufklärung.
Intensive Verbindungen zwischen Künstlern, Literaten und Wissenschaftlern prägten die preußisch-sächsischen Beziehungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – der Hochzeit der Aufklärung.
Publizistische Tätigkeiten und gesellige Zusammenkünfte der sogenannten Gelehrten in Preußen und Sachsen ermöglichten erst richtungsweisende Entwicklungen der Aufklärung – gerade wegen der Nähe und Konkurrenz der Nachbarländer. Der fruchtbare Dialog spielte sich in Hochschulen, Akademien, gelehrten Gesellschaften, Büchern und Zeitschriften
ab, aber auch in privaten Briefwechseln. Ein wechselseitiger Austausch auf allen Ebenen!
Szene 7
Heute Sachse, morgen Preuße
 Der Wiener Kongress von 1814/15 zog neue Grenzen. Sachsen musste an den Kriegsgewinner Preußen fast zwei Drittel seines Territoriums abtreten. Die Untertanen wurden nicht gefragt.
Der Wiener Kongress von 1814/15 zog neue Grenzen. Sachsen musste an den Kriegsgewinner Preußen fast zwei Drittel seines Territoriums abtreten. Die Untertanen wurden nicht gefragt.
In den Napoleonischen Kriegen hatte Sachsen lange als Verbündeter Frankreichs ausgeharrt. Als der Stern Napoleons sank, ging auch Sachsen unter. Preußens Ehrgeiz, sich das ganze Nachbarterritorium einzuverleiben, wurde auf dem Wiener Kongress nicht befriedigt. Zu sehr fürchteten die anderen Staaten den preußischen Machtgewinn. In Wien wurde um Länder, Grenzen und um Menschen gefeilscht. Der Kongress tanzte nicht nur, er vermaß Europa.

Katalog & Kurzführer
Kultureller und wirtschaftlicher Austausch oder Rivalität und offene Feindschaft? Der Katalog erzählt in sieben Szenen die wechselvolle und mitunter schwierige Beziehungsgeschichte der Nachbarländer Preußen und Sachsen.
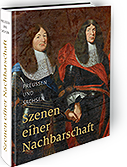
Preußen und Sachsen. Szenen einer Nachbarschaft
Herausgegeben von Frank Göse / Winfried Müller / Kurt Winkler / Anne-Katrin Ziesak für das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte
SANDSTEIN Verlag, Dresden 2014, ca. 530 Seiten, ca. 460 Abbildungen, 28 × 22 cm
Museumsausgabe: Klappenbroschur | ISBN 978-3-95498-105-2 | 25 Euro
Buchhandelsausgabe: Festeinband | ISBN 978-3-95498-084-0 | ab 1. Juni 2014: 48 Euro / Subskriptionspreis bis 31. Mai 2014: 28 Euro
Preußen und Sachsen. Szenen einer Nachbarschaft. Kurzführer
Hg. von Peter Langen und Anne-Katrin Ziesak für das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte
SANDSTEIN Verlag, Dresden 2014, 48 Seiten, 28 Abbildungen, 22 × 14 cm
Broschur | ISBN 978-3-95498-110-6 | 5 Euro
www.sandstein.de

Trailer zur Landesausstellung
wo Preußen Sachsen küsst
Spielfilmspots zur Ersten Brandenburgischen Landesausstellung
Making-Of
Eine Produktion von Studierenden der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" Potsdam-Babelsberg (HFF)
© HFF 2014

Schirmherrschaft
Die Erste Brandenburgische Landesausstellung steht unter der gemeinsamen Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg Dr. Dietmar Woidke und des Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen Stanislaw Tillich.

Akteure
Träger
Ausgerichtet wird die Ausstellung vom Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) in
Potsdam.
Kuratorium und Fachbeirat
Ein Kuratorium unter dem Vorsitz von Brandenburgs Kulturministerin Sabine Kunst und ein Fachbeirat stehen dem HBPG zur Seite. In beiden Gremien sind sowohl brandenburgische als auch sächsische Einrichtungen vertreten. Sprecher des Fachbeirates sind Prof. Dr. Frank Göse, Historisches Institut Universität Potsdam, sowie Prof. Dr. Winfried Müller, Direktor des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V.
Kooperationspartner
Durchgeführt wird die Erste Brandenburgische Landesausstellung in Verbindung mit dem Historischen Institut der Universität Potsdam, dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum, dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv sowie dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde und dem Sorbischen Institut. Zahlreiche weitere Partner in Brandenburg und Sachsen unterstützen das Vorhaben, darunter die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
Das Team
Gesamtleitung
Dr. Kurt Winkler, Projektleiter, Direktor des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte
Katja Meyer, Referentin
Bereich Ausstellung, Publikationen, Vermittlung
Anne-Katrin Ziesak, Leitung, Kuratorin der Ersten Brandenburgischen Landesausstellung
Peter Langen, Wissenschaftliche Mitarbeit
Dr. Ewa Gossart, Registrarin
Dana Kresse, Vermittlung, Museumspädagogik
Stephan Gutschmidt, Assistent im Bereich Ausstellung, Publikation, Vermittlung
Bereich Organisation, Finanzen, Betrieb
Samo Darian, Leitung
Katja Meyer, Stellv. Leitung Organisation, Finanzen, Betrieb
Bettina Scharf, Leitung Veranstaltungen, Kooperationen, Ticketing
Christin Münch, Veranstaltungskalender
Ulrike Strube, Leitung Besucherservice, Konzeption Schülerfahrten
Karina Wisniewski, Stellv. Leitung Besucherservice,
Kerstin Petzold, Mitarbeit Besucherservice/Schülerfahrten
Ina Plitta, Mitarbeit Schülerfahrten /Buchungen
Bereich Kommunikation
Elke Scheler, Leitung
Dr. Antje Frank, Pressearbeit, Medienpartnerschaften
Kirsten Foemmel, Marketing, Social Media
Christine Oehrlein, Grafik, Mediaplanung
Christian Huber, Vertrieb
Ausstellungsarchitektur und Corporate Design
gewerk design, Berlin
Ausstellungsgrafik
Team VIERZIG A, Dessau
Museumsbetrieb
WWS Strube GmbH

 Als weltweit erste große kulturhistorische Ausstellung wird die Erste Brandenburgische Landesausstellung die spannungsreiche Beziehungsgeschichte der Nachbarländer Preußen und Sachsen erzählen.
Als weltweit erste große kulturhistorische Ausstellung wird die Erste Brandenburgische Landesausstellung die spannungsreiche Beziehungsgeschichte der Nachbarländer Preußen und Sachsen erzählen. Das 200. Jubiläum des Wiener Kongresses von 1814/15 gibt den Anlass für die Landesausstellung. In seiner Folge wurde Europa neu geordnet, und große Teile von Sachsen fielen an Preußen, darunter auch die Niederlausitz sowie die Hälfte der Oberlausitz – die Region, »wo Preußen Sachsen küsst«. Von einem Tag zum anderen wurden die dort lebenden Menschen von Sachsen zu Preußen. Spuren dieser wechselvollen Vergangenheit finden sich in Südbrandenburg bis heute.
Das 200. Jubiläum des Wiener Kongresses von 1814/15 gibt den Anlass für die Landesausstellung. In seiner Folge wurde Europa neu geordnet, und große Teile von Sachsen fielen an Preußen, darunter auch die Niederlausitz sowie die Hälfte der Oberlausitz – die Region, »wo Preußen Sachsen küsst«. Von einem Tag zum anderen wurden die dort lebenden Menschen von Sachsen zu Preußen. Spuren dieser wechselvollen Vergangenheit finden sich in Südbrandenburg bis heute. Stattfinden wird die Erste Brandenburgische Landesausstellung in der Doppelstadt Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster, einem für das Thema der großen Ausstellung authentischen Ort. Schauplatz und zugleich Herzstück der Ausstellung ist Schloss Doberlug, das ehemals zum Besitz der Kurfürsten von Sachsen zählte. Mit der Landesausstellung wird das sorgfältig sanierte Renaissanceschloss, die »sächsische Perle Brandenburgs«, erstmals wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Stattfinden wird die Erste Brandenburgische Landesausstellung in der Doppelstadt Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster, einem für das Thema der großen Ausstellung authentischen Ort. Schauplatz und zugleich Herzstück der Ausstellung ist Schloss Doberlug, das ehemals zum Besitz der Kurfürsten von Sachsen zählte. Mit der Landesausstellung wird das sorgfältig sanierte Renaissanceschloss, die »sächsische Perle Brandenburgs«, erstmals wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Musenküsse, Verräterküsse, Pferdeküsse: Die Ausstellung beleuchtet auf über 800 Quadratmetern die Eigenart und Bedeutung der preußisch-sächsischen Beziehungen, ihre Höhen und Tiefen, ihre Licht- und Schattenseiten und setzt sich mit den unterschiedlichsten sozial-, kultur- und geistesgeschichtlichen Aspekten der preußisch-sächsischen Nachbarschaft auseinander. Dabei werden nicht zuletzt auch die Klischees von Sachsens Glanz und Preußens Gloria hinterfragt.
Musenküsse, Verräterküsse, Pferdeküsse: Die Ausstellung beleuchtet auf über 800 Quadratmetern die Eigenart und Bedeutung der preußisch-sächsischen Beziehungen, ihre Höhen und Tiefen, ihre Licht- und Schattenseiten und setzt sich mit den unterschiedlichsten sozial-, kultur- und geistesgeschichtlichen Aspekten der preußisch-sächsischen Nachbarschaft auseinander. Dabei werden nicht zuletzt auch die Klischees von Sachsens Glanz und Preußens Gloria hinterfragt.
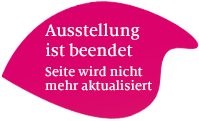

 Ein Händedruck für die Ewigkeit. Freundschaftsbildnisse der Herrscher von Brandenburg-Preußen und Sachsen halten die Verbundenheit fest. Die dargestellte Eintracht der beiden Nachbarn entsprach jedoch nicht immer der Wirklichkeit.
Ein Händedruck für die Ewigkeit. Freundschaftsbildnisse der Herrscher von Brandenburg-Preußen und Sachsen halten die Verbundenheit fest. Die dargestellte Eintracht der beiden Nachbarn entsprach jedoch nicht immer der Wirklichkeit.  Anfang des 18. Jahrhunderts entstand dieser kostbare Pokal als gemeinsames Werk des sächsischen Bildhauers Balthasar Permoser und des preußischen Goldschmieds Bernhard Quippe.
Anfang des 18. Jahrhunderts entstand dieser kostbare Pokal als gemeinsames Werk des sächsischen Bildhauers Balthasar Permoser und des preußischen Goldschmieds Bernhard Quippe. Der Wappenschild mit Kurschwertern und Rautenkranz gehört dem Kurfürsten von Sachsen, der rote Adler kennzeichnet den Brandenburger. Gemeinsam stehen die Kurfürsten ein für das lutherische Bekenntnis.
Der Wappenschild mit Kurschwertern und Rautenkranz gehört dem Kurfürsten von Sachsen, der rote Adler kennzeichnet den Brandenburger. Gemeinsam stehen die Kurfürsten ein für das lutherische Bekenntnis.  Landesgrenzen hatten wenig Bedeutung für den Adel in Preußen und Sachsen. Dies lässt sich an der Ahnentafel des Johann von Schöning ablesen.
Landesgrenzen hatten wenig Bedeutung für den Adel in Preußen und Sachsen. Dies lässt sich an der Ahnentafel des Johann von Schöning ablesen. Im fröhlichen Reigen drehen sich drei Grazien. Es sind die Verkörperungen Sachsens, Polens und Frankreichs. Sie feiern die Vermählung einer sächsischen Prinzessin mit dem französischen Thronfolger 1747.
Im fröhlichen Reigen drehen sich drei Grazien. Es sind die Verkörperungen Sachsens, Polens und Frankreichs. Sie feiern die Vermählung einer sächsischen Prinzessin mit dem französischen Thronfolger 1747. Intensive Verbindungen zwischen Künstlern, Literaten und Wissenschaftlern prägten die preußisch-sächsischen Beziehungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – der Hochzeit der Aufklärung.
Intensive Verbindungen zwischen Künstlern, Literaten und Wissenschaftlern prägten die preußisch-sächsischen Beziehungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – der Hochzeit der Aufklärung. Der Wiener Kongress von 1814/15 zog neue Grenzen. Sachsen musste an den Kriegsgewinner Preußen fast zwei Drittel seines Territoriums abtreten. Die Untertanen wurden nicht gefragt.
Der Wiener Kongress von 1814/15 zog neue Grenzen. Sachsen musste an den Kriegsgewinner Preußen fast zwei Drittel seines Territoriums abtreten. Die Untertanen wurden nicht gefragt.